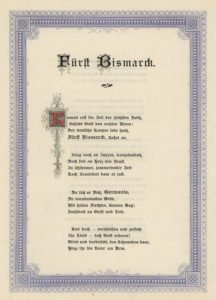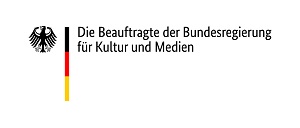Geschrieben von Dr. Maik Ohnezeit am Mittwoch, den 29. April 2015 um 12:51 Uhr

Anlässlich des 200. Geburtstages von Otto von Bismarck im Jahr 2015 präsentieren die bundesunmittelbare Otto-von-Bismarck-Stiftung und das Bismarck-Museum in Bad Kissingen ein gemeinsames Ausstellungsprojekt unter dem Motto „3 Museen – 3 Ausstellungen“: Die Sonderausstellung „Bismarck: Familie – Politik – Mythos“ thematisiert anhand zahlreicher Exponate den familiären Hintergrund, die Politik sowie die Mythisierung Otto von Bismarcks. Ausstellungsorte sind die drei Bismarck-Museen in Bad Kissingen, Friedrichsruh und Schönhausen/Elbe, die jeweils einen Teilaspekt der gemeinsamen Sonderausstellung behandeln.
Während sich das Bismarck-Museum Schönhausen, das sich im erhaltenen Seitenflügel des ehemaligen Geburtshauses Otto von Bismarcks befindet, dessen familiären Ursprüngen widmet, präsentiert das Bismarck-Museum in der Oberen Saline, von Bismarck einst als Wohnung während seiner Kuraufenthalte in Bad Kissingen genutzt, zentrale Aspekte seiner Außenpolitik. Die geradezu kultische Verehrung Bismarcks wird schließlich im Bismarck-Museum Friedrichsruh, am ehemaligen Wohn- und Alterssitz des ersten Reichskanzlers im Sachsenwald, beleuchtet.
Am Sonntag, den 26. April, war es endlich soweit: Der 3. Teil der gemeinsamen Sonderausstellung wurde feierlich eröffnet. Rund 100 Gäste waren der Einladung der Otto-von-Bismarck-Stiftung in das historische Bahnhofsgebäude von Friedrichsruh gefolgt und lauschten den einführenden Worten des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds der Stiftung, Prof. Dr. Ulrich Lappenküper, sowie dem Festvortrag zum „Bismarck-Mythos“ von Peter Weidisch M.A., Kulturreferent der Stadt Bad Kissingen und Leiter des dortigen Bismarck-Museums in der Oberen Saline. Dr. Maik Ohnezeit führte anschließend als Kurator in die Sonderausstellung ein. Im Anschluss an die Vorträge konnten sich die Besucher bei einem kleinen Empfang die Sonderausstellung im Bismarck-Museum ansehen.
Friedrichsruh als ehemaliger Wohn- und Alterssitz Otto von Bismarcks war über Jahrzehnte Anlaufstation für die Verehrer des ersten Reichskanzlers aus aller Welt. Die Sonderausstellung beleuchtet Ausprägung und Bedeutung der kultischen Verehrung des „Reichsgründers“ vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik hinein. Denkmäler verschiedenster Art wie Feuersäulen, Türme und Standbilder, von denen viele bis heute existieren, waren ihm zu Ehren errichtet, weltweit Straßen, Plätze und Städte nach ihm benannt worden. Hinzu trat die literarische und künstlerische Verehrung, die sich in vielfältigen Formen wie Gedichten, Lebensbeschreibungen, musikalischen Kompositionen, Gemälden, Medaillen und Fotografien ausdrückte.
Gezeigt werden zahlreiche, bisher der Öffentlichkeit nicht bekannte Zeugnisse dieser Verehrung, darunter kunstvoll gestaltete Ehrenbürgerbriefe und Grußadressen sowie Briefe von Privatpersonen, die darin ihre Verbundenheit mit dem „Reichsgründer“ bekunden. Bestaunt werden kann aber auch eine Auswahl von Konsumgütern, die den Namen „Bismarck“ trugen (und zum Teil bis heute tragen).
Die Sonderausstellung läuft bis zum 20. September 2015.




 Geht man durch das Bismarck-Museum in Friedrichsruh, fällt im zweiten Raum der Blick auf eine Soldatenstatuette, die Bismarck von den Offizieren seines ehemaligen Bataillons zum 80. Geburtstag geschenkt bekam. Wenig ist bisher über seine Soldatenzeit bekannt.
Geht man durch das Bismarck-Museum in Friedrichsruh, fällt im zweiten Raum der Blick auf eine Soldatenstatuette, die Bismarck von den Offizieren seines ehemaligen Bataillons zum 80. Geburtstag geschenkt bekam. Wenig ist bisher über seine Soldatenzeit bekannt.