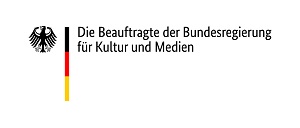Bismarcks fast ausgefallener 100. Geburtstag zwischen den Fronten
Was hätten das für Feiern werden können? Am 1. April 1915 wäre für die Bismarck-Deutschen ein einmaliger Nationalfeiertag gewesen, für den vielleicht sogar Wilhelm II. schulfrei gegeben hätte. Und wenn nicht, dann hätten die protestantischen Studienräte zwischen Rheinland und Ostpreußen ihren Schülern auf eigene Faust einen patriotischen Frühlingstag verordnet. Ergreifende Reden und stolze Lieder wurden zwar wie geplant landauf, landab vorgetragen, aber unter völlig anderen Bedingungen.
Bismarcks 100. Geburtstag war langfristig vorbereitet worden. Neue Bismarcktürme waren errichtet, vorhandene herausgeputzt worden, der Bau eines Bismarck-Nationaldenkmals war beschlossene Sache, Historiker und Publizisten saßen über den Manuskripten neuer Biographien über den Reichskanzler und eine ganze Kitschartikel-Industrie bereitete sich auf den reißenden Absatz von Aschenbechern, Rasierklingen und Wandtellern mit dem Antlitz des Verehrten vor. Doch dann befand sich das Deutsche Reich seit August 1914 in jenem Krieg, den der verklärte “Alte” immer hatte vermeiden wollen. Ob er es 1914 überhaupt gekonnt hätte? Diese Frage beantwortete die Mehrheit der Deutschen mit einem deutlichen Ja. Die Einwände der Sozialdemokraten, einiger Zentrumsangehöriger und Linksliberaler wurden von einem Hurra-Patriotismus übertönt, der seit dem letzten Lebensjahrzehnt Bismarcks eigenartige Formen angenommen hatte.