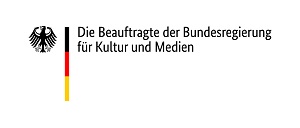Geschrieben von Dr. Ulf Morgenstern am Mittwoch, den 27. Januar 2016 um 16:40 Uhr

Denkmäler ragen oft wie Relikte aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart. Längst vergessene Ehr-Regime haben einen Geehrten in Stein oder Kupfer in den öffentlichen Raum gestellt. Und mit dieser Setzung muss man klarkommen, auch wenn der Bezug zur Thema sich geändert hat oder verloren gegangen ist. Die laustarke Initiative „Rhodes must fall“ in Südafrika und England zeigt den in Bezug auf Personenkult sensiblen Deutschen, dass auch andernorts schwierige einstige Helden durch die Hintergrundfilme des Alltagslebens spuken.
Erfrischend ist, wie reflektiert man auf die geschichtsvergessenen Wünsche nach der einfachen Lösung der Bilderstürmerei (was ist nicht sehe, hat es auch nicht gegeben) reagiert. Nämlich nicht mit der bockigen Abwehrhaltung der unkritischen Verklärer von Monarchie und Republik im Kolonialzeitalter. Natürlich muss die Verherrlichung des Empires (nicht des Vereinigten Königreiches) dort ebenso den tempi passati angehören, wie es in Deutschland mit den Relikten vermeintlicher kolonialer Heldentaten sein sollte, die eigentlich Kriegsverbrechen waren. Sollten aber alle Spuren kolonialer Geschichte im öffentlichen Raum verschwinden?
Oder in welcher Form sollten sie entschärft oder ironisiert werden? Darüber wird gegenwärtig diskutiert. Deutschland holt damit die Beschäftigung mit einem Thema nach, das über Jahrzehnte marginalisiert und später zunächst nur aus europäischer Perspektive in den Blick genommen wurde. Alltagserfahrungen globaler Dynamiken haben nun zunehmend zu der Einsicht geführt, dass Kolonialgeschichte kein alleiniges Phänomen von Kolonien und kleinen Eliten in den „Mutterländern“ war, sondern eine gesamtgesellschaftliche Dimension weit über das Ende der formalen Kolonialzeit hinaus hat. Wissmann-, Woermann- und Trotha-Straßen und -denkmäler sind bis heute beredte Zeugnisse, weniger plakative Beispiele gibt es zu Hauf.
In der englischen Öffentlichkeit diskutiert man gegenwärtig darüber, wie man den wüsten Imperialisten Rhodes einhegen kann. Dort, wo er im öffentlichen Raum unkommentiert aufwartet, soll er nun durch Hinweistafeln kontextualisiert werden. „Konstruktiv“ nennt das Deutschlandradiokultur. „Sinnvoll und abgewogen“, nennen wir das aus der Sicht der Bismarck-Forschung. Dass man dabei nebenher noch etwas lernen kann, ja sogar dem vielbeschworenen historisch-politischen Bildungsauftrag nachkommen kann, in dem den moralisch nicht mehr haltbaren Bock durch Informationen über ihn zum Gärtner des historischen Wissens macht, zeigen in Punkto Bismarck die Ost-Thüringer in Gera. Aber die waren immer schon pfiffig und unaufgeregt.
Die lässige Haltung der alliierten Soldaten vor einem Bismarck-Denkmal auf dem Bild zeigt, dass man die Blochsche „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ aushalten kann, wenn man weiß, dass man historisch gewonnen hat.