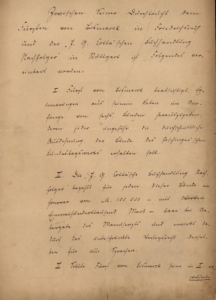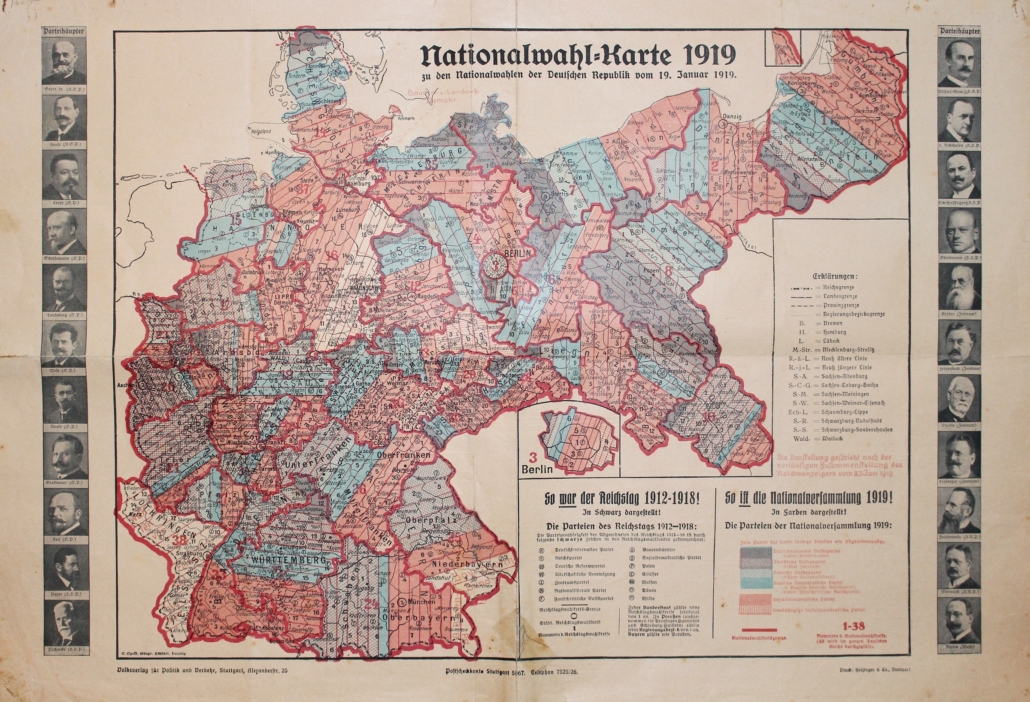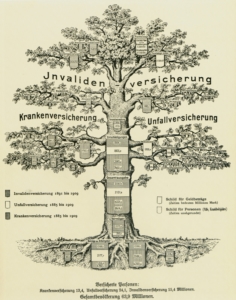Darstellung der Schlacht bei Bornhöved im Jahr 1227 in der Sächsischen Weltchronik (14. Jahrhundert).
Schleswig-Holstein und das Herzogtum Lauenburg: Zwei Geschichten oder eine? – Eine eindeutige Antwort auf diese Frage ist unmöglich, wie Prof. Dr. Oliver Auge (Universität Kiel) in seinem Abendvortrag aufzeigte. Dieser fand als Kooperationsveranstaltung mit der Stiftung Herzogtum Lauenburg online statt und stieß durch die Unabhängigkeit von Wetter und Pandemie auf eine sehr erfreuliche Resonanz.
Oliver Auge ist Direktor der Abteilung Regionalgeschichte mit Schwerpunkt Schleswig-Holstein am Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowie Autor und (Mit-)Herausgeber verschiedener regionalgeschichtlicher Publikationen. Für seinen Vortrag schöpfte er aus dem reichen Fundus seiner langjährigen Forschungsergebnisse. Am Beispiel ausgewählter historischer Ereignisse zeigte er auf, dass die Eingliederung des Herzogtums Lauenburg 1876 in die preußische Provinz Schleswig-Holstein keineswegs der zwangsläufige Schlusspunkt einer längeren Entwicklung war. Tatsächlich habe im Landkreis noch Jahrzehnte Unsicherheit darüber geherrscht, wohin man gehöre: 1946 sei in Mölln diskutiert worden, ob man sich statt dem neuen Bundesland Schleswig-Holstein nicht besser Niedersachsen angliedern solle. Es war der ferne Nachhall der eigenen Geschichte, die lange von askanischen und welfischen Herzögen geprägt wurde.