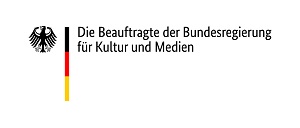80 Jahre Kriegsende – Frieden: Auftakt mit Vortrag über die Rettungsaktion Weiße Busse

Die „Weißen Busse“ wurden vor ihrem Einsatz im Sachsenwald abgestellt. (Bildarchiv des Dänischen Nationalmuseums)
Zum Auftakt der Aumühler Veranstaltungsreihe „80 Jahre Kriegsende – Frieden“ war am vergangenen Donnerstag die Historikerin Ulrike Jensen eingeladen. Sie ist in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme für die politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen zuständig und hatte für ihre Magisterarbeit die Rettungsaktion Weiße Busse erforscht. Ihr Schwerpunkt lag dabei auf Interviews mit ehemaligen skandinavischen Häftlingen, die das schwedische Rote Kreuz kurz vor Kriegsende gerettet hatte. Organisatorische Knotenpunkte waren das damalige KZ Neuengamme und der Sachsenwald bei Friedrichsruh.

Ulrike Jensen in Friedrichsruh
Ulrike Jensen hat über ihre Forschungsergebnisse im August 2020 bereits einmal im Historischen Bahnhof Friedrichsruh berichtet (siehe: Eine bittere Rettung. Vortrag über die Aktion „Weiße Busse“ im Frühjahr 1945). Das Interesse war auch jetzt, fünf Jahre später und fast auf den Tag 80 Jahre nach der Rettungsaktion, wieder sehr groß. Dies zeigte sich auch an den lebhaften Fragen aus dem Publikum.
Im März und April 1945 waren 7.000 bis 8.000 KZ-Häftlinge, die aus Dänemark und Norwegen stammten, sowie eine ähnliche Anzahl an nicht-skandinavischen Menschen aus verschiedenen Konzentrationslagern zunächst nach Neuengamme gebracht und dann nach Schweden evakuiert worden. Nach einigen vorherigen Bemühungen und ersten Kontakten, die bereits geknüpft waren, hatte der schwedische Diplomat Folke Bernadotte Graf von Wisborg Heinrich Himmler überredet, der Rettung dieser Häftlinge zuzustimmen. Himmlers Zusage sei mutmaßlich damit zu erklären, so Ulrike Jensen, dass er sich gegenüber den Westmächten als Nachfolger Hitlers positionieren und eine gute Ausgangslage für Verhandlungen über einen Separatfrieden schaffen wollte.
Deutlich wurde, dass die Quellenlage zur Rettungsaktion nach wie vor sehr schlecht ist. Bis heute sei unbekannt, erklärte Ulrike Jensen, wie viele Menschen im sogenannten Skandinavier-Lager im KZ Neuengamme untergebracht gewesen seien. Erhaltene Dokumente zeigten aber, dass das Konzentrationslager gegen Kriegsende insgesamt zu 600 Prozent überbelegt gewesen sei. In den Mittelpunkt ihres Vortrags stellte sie das persönliche Erleben der skandinavischen KZ-Häftlinge. Diese hätten kleinere Pakete des schwedischen Roten Kreuzes empfangen dürfen, die oftmals ihr Überleben gesichert hätten. Allerdings sei ihnen – wie sich in den Zeitzeugen-Gesprächen gezeigt habe – schmerzhaft bewusst gewesen, dass sie damit so wenig erhalten hatten, dass sie anderen Gefangenen kaum oder überhaupt nicht helfen konnten. Menschen aus Polen, der Ukraine und Russland sei es untersagt gewesen, Pakete zu empfangen.
Auch die Busfahrer aus Dänemark und Schweden, die sich freiwillig für die Rettungsaktion gemeldet hatten, seien mit der NS-Gewaltherrschaft unmittelbar konfrontiert gewesen: Um Platz im KZ Neuengamme für diejenigen zu schaffen, die evakuiert werden sollten, mussten zunächst die meist sterbenskranken Häftlinge aus dem sogenannten Schonungsblock in andere Konzentrationslager gebracht werden. In dieses Vorgehen eingebunden zu werden, erlebten die meist jungen Busfahrer als traumatisch, wie Ulrike Jensen am Beispiel einiger Zitate aufzeigte.
In den späteren Zeitzeugenberichten sei eine sehr große Dankbarkeit für die Rettungsaktion Weiße Busse deutlich geworden. Geblieben seien aber auch Schuldgefühle gegenüber den Häftlingen aus anderen Ländern. Die damals inhaftierten Skandinavier und Busfahrer hätten selbstverständlich gewusst, dass sie keinerlei Schuld getroffen habe, sagte Ulrike Jensen. Aber sie hätten sich in der schweren Zeit ihr Gefühl für Menschlichkeit bewahrt.